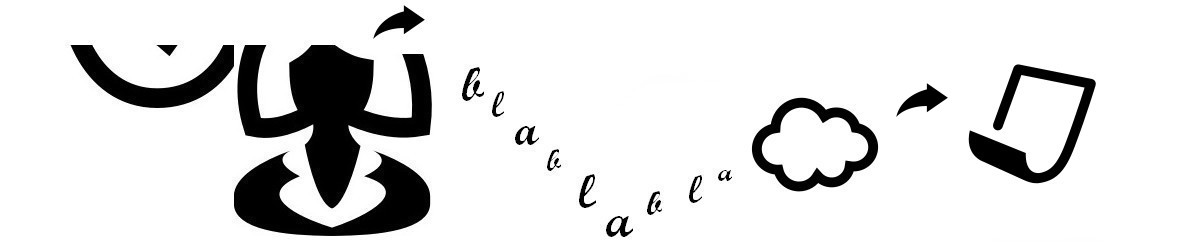Anlässlich des 1. Mai hat MDR-Figaro einen Vortrag des Jenaer Soziologen Hartmut Rosa wiederholt gesendet, den er bereits am 22. Juni 2013 im Rahmen der Konferenz „Das System des Kapitalismus – Grundlagen, Dynamik und Kritik“ in Dresden gehalten hat. Die titelgebende Frage „Hat sich der Kapitalismus totgesiegt?“ lädt geradezu dazu ein, den Vortrag inhaltlich und thesenhaft auf den „Tag der Arbeit“ zu beziehen und damit spielerisch seinem Bedeutungsverlust auf den Zahn zu fühlen.
Anlässlich des 1. Mai hat MDR-Figaro einen Vortrag des Jenaer Soziologen Hartmut Rosa wiederholt gesendet, den er bereits am 22. Juni 2013 im Rahmen der Konferenz „Das System des Kapitalismus – Grundlagen, Dynamik und Kritik“ in Dresden gehalten hat. Die titelgebende Frage „Hat sich der Kapitalismus totgesiegt?“ lädt geradezu dazu ein, den Vortrag inhaltlich und thesenhaft auf den „Tag der Arbeit“ zu beziehen und damit spielerisch seinem Bedeutungsverlust auf den Zahn zu fühlen.
1990 erschien unter dem Titel „100 Jahre Zukunft“ ein Band über die Geschichte des 1. Mai, herausgegeben von Inge Marßolek. Der Kampf- und Feiertag, so macht es der Titel anlässlich des 100. Jahrestages deutlich, ist ohne den Begriff der Utopie nicht denkbar. Diese meint im Kontext der an sozialistischen Ideen ausgerichteten Arbeiterbewegung den zuversichtlichen und hoffnungsvollen Blick in Richtung Zukunft, der „Befreiung des Proletariats“.
Hoffnungsvoll der Sonne entgegen
Auf Plakaten war dies oft symbolisch einleuchtend die aufgehende Sonne, der die Menschen energisch entgegenlaufen. Auf ihrem Strahlenkranz prangte nicht selten der Schriftzug „1. Mai“ als froher Hoffnungstag. Nun ist das nicht allzu verwunderlich, denn der 1. Mai ist ebenfalls ein fester Brauchtumstermin, an dem – anknüpfend an Walpurgis des Vorabends – der Frühling eingeläutet wird.
So verbindet sich beispielhaft in der Sonne die Frühlingsmetaphorik der Maibräuche mit den Bestrebungen der Arbeiterbewegung, die – so viel Bildsprache sei hier gestattet – den eisigen Winter unmenschlicher Arbeitsverhältnisse in den Fabriken mit 12- bis 14-Stunden-Tagen, hoher Unfallhäufigkeit, Kinderarbeit und körperlich-geistigen Folgeschäden, zu überwinden sucht und kollektiv entsprechende Forderungen stellt, allen voran den Achtstundentag.
 Diese Möglichkeiten der Verbesserung wiesen stets auf einen Punkt, an dem sie hoffentlich einmal durchgesetzt sein werden: in die Zukunft. Und rückblickend ist das die heutige Zeit.
Diese Möglichkeiten der Verbesserung wiesen stets auf einen Punkt, an dem sie hoffentlich einmal durchgesetzt sein werden: in die Zukunft. Und rückblickend ist das die heutige Zeit.
Kampftag der Arbeiterschaft?
Mehr als 100 Jahre nach den ersten Maidemonstrationen hat der 1. Mai seine Bedeutung als Arbeiterkampftag allerdings eingebüßt. Er ist in erster Linie Feiertag. Die Gründe dafür liegen zum Teil auf der Hand: Der Achtstundentag ist durchgesetzt und die Arbeitsbedingungen haben sich, nicht nur in der Produktion, mit fortschreitender Modernisierung und Technisierung verbessert. Was allerdings noch stärker wiegt: Die sozialistische Idee, aus der sich der 1. Mai seit seinen Anfängen gespeist hat, ist historisch gescheitert.
Andererseits finden sich mögliche Gründe im Kapitalismus selbst. Denn der 1. Mai ist seit jeher eine Reaktion auf die kapitalistischen Produktionsverhältnisse im Zuge der Industrialisierung.
Sie war seit dem späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert die Beschleunigungsphase der Moderne schlechthin – oder besser: in die Moderne. Die zahlreichen technischen Neuerungen und die Entwicklung von der Agrar- zur Industriegesellschaft sind Grundvoraussetzungen dieser „neuen Zeit“.
Totale Beschleunigung aller Lebensbereiche
Von den beschleunigten und beschleunigenden Veränderungen im Sinne gesellschaftlicher, ökonomischer und kultureller Umstrukturierung waren alle Lebensbereiche ergriffen: Von Massenproduktion und Verstädterung bis zu Bevölkerungsexplosion und Pauperismus.
Dieser Beschleunigungsprozess findet nach wie vor statt und wir leben heute geradezu in einem „Beschleunigungstotalitarismus“. Das jedenfalls sagt Hartmut Rosa in seinem Vortrag „Hat sich der Kapitalismus totgesiegt?“. Von Totalitarismus sei dann die Rede, wenn alle Bevölkerungsgruppen und alle Lebensbereiche gleichermaßen betroffen sind, so Rosa.
Diese These des Jenaer Soziologen und Beschleunigungstheoretikers basiert auf der Feststellung, dass das Grundmotiv des Wirtschaftens im Kapitalismus gar nicht primär Tauschgeschäfte im Sinne von Marktwirtschaft sind, sondern Kapitalmaximierung im Sinne eines Steigerungszwangs, dessen Grundvoraussetzung Schnelligkeit und technische Beschleunigung ist: Wer zuerst da ist, mahlt zuerst.
Wachstum für den Status quo
Gewinnmaximierung ist also die Triebfeder des Kapitalismus – das sollte allerspätestens seit der Finanzkrise 2008 deutlich geworden sein. Allerdings vermutet Hartmut Rosa dahinter weniger die Geldgier, als nackte Angst. Denn die Dynamisierung sei systemimmanent und ein knackiger Systemfehler: Die permanente Steigerung und Beschleunigung ist notwendig, um den Status quo zu erhalten. Rosa sagt:
„Damit wir bleiben, wie wir sind, müssen wir jedes Jahr schneller laufen.“
Das Grundversprechen der Moderne, Konkurrenzkampf und Knappheit zu überwinden, um selbstbestimmt in Freiheit leben zu können, unterläuft der Kapitalismus geschickt. Denn ein Ende der Steigerung – das größtmögliche Wachstum – ist nie erreicht. Die Beschleunigung läuft auf keinen Zielpunkt zu, sie ist Mittel zum Zweck. Hartmut Rosa bezeichnet das als dynamische Stabilisierung.
Die Verhältnisse zum Tanzen bringen
Dabei weist er ausdrücklich darauf hin, dass Dynamisierung per se nicht schlecht ist, sondern entwicklungshistorisch gut und wichtig. Problematisch sei Dynamisierung im Sinne permanenten Wachstums, das sich stets aufs Neue in einem „Prozess der Landnahme“ (Stephan Lessenich) neue Märkte, Länder und Lebensstile einverleibt. Der Mensch und seine Lebenszeit gerieren in diesem Kontext zur Ressource, die in politisch-ökonomischer Perspektive zu aktivieren ist. Dies geschieht gleichsam mit anderen Lebens- und Gesellschaftsbereichen, wie Politik und Bildung, die nur noch als Dienstleister der Ökonomie fungieren. Rosa definiert:
„Also kann man sagen, Kapitalismus bedeutet das immer schnellere In-Bewegung-Setzen der materiellen, sozialen und der geistigen Welt. Wir bringen die Verhältnisse zum Tanzen.“
Nackte Angst und keine Utopie
Was Hartmut Rosa hier auf Karl Marx verweisend als Tanzen bezeichnet, ließe sich heute treffender durch die Formulierung des „Sich-Drehens“ – im Tanzen – ersetzen, das In-Bewegung-Bleiben meint, um nicht abgehängt zu werden – das gilt für Personen und Unternehmen gleichermaßen. Hier ist sie wieder, die Angst, die sich „psychisch“ total auswirkt.
Wenn man die Thesen Hartmut Rosas aus seinem Vortrag zusammenfasst, ließe sich in etwa folgendes formulieren:
Wo der Kapitalismus alle Bevölkerungsgruppen und Lebensbereiche erfasst, um sie zum immer schnellerem „Drehen“ zu bringen, ist ziellose Beschleunigung als Grundvoraussetzung von Wirtschaftswachstum lediglich die Dynamisierung des Augenblicks – des Hier und Jetzt. Ebenso wie man beim „Sich-Drehen“ an einem Ort verbleibt, egal wie viel Energie man dabei aufwendet und sich erschöpft, hat Zukunft dort keinen Platz, wo alles bleiben soll, wie es ist – erst recht nicht, wenn Stabilität immer mehr Beschleunigung und Zeitaufwand benötigt.
Ein Ort, der nicht ist
Hartmut Rosa spricht von Desynchronisation, wo einige Bereiche nicht derart problemlos dynamisierungs- und steigerungsfähig sind, etwa die Realökonomie gegenüber der Finanzökonomie oder die Demokratie, Ökologie und Psyche des Menschen gegenüber der Ökonomie. All diese Dinge benötigen Zeit, jenen „knappsten Rohstoff“, der vor allem Lebenszeit ist.
 Auch in diesem Sinne ist Zukunftsdenken deplatziert, denn Nachhaltigkeit ist zeitaufwendig. Und wo ein Blick in die Zukunft schwer realisierbar ist, muss Utopie ein Hirngespinst sein oder das, was sie ihrer Wortherkunft tatsächlich ist: kein Ort, nirgends. Erst recht, wenn für solche Vorstellungsräume gar keine Zeit bleibt, weil man Zeit seines Lebens damit beschäftigt sein wird, finanziell und sozial hinterherzukommen, mitzuhalten und nicht abgehängt zu werden. Die Angst ist groß – alles andere wiegt dagegen wenig.
Auch in diesem Sinne ist Zukunftsdenken deplatziert, denn Nachhaltigkeit ist zeitaufwendig. Und wo ein Blick in die Zukunft schwer realisierbar ist, muss Utopie ein Hirngespinst sein oder das, was sie ihrer Wortherkunft tatsächlich ist: kein Ort, nirgends. Erst recht, wenn für solche Vorstellungsräume gar keine Zeit bleibt, weil man Zeit seines Lebens damit beschäftigt sein wird, finanziell und sozial hinterherzukommen, mitzuhalten und nicht abgehängt zu werden. Die Angst ist groß – alles andere wiegt dagegen wenig.
Was bedeutet das für den 1. Mai?
Die Utopie von der Befreiung des Proletariats und die Arbeiterbewegung an sich waren von Beginn an kollektiv: Gleiche Interessen, gleiche Forderungen, die verbunden haben. In einer pluralistischen Gesellschaft, in der es viele unterschiedliche Arten von Arbeitsverhältnissen gibt, mag das schwieriger sein. Aber mit Blick an die Ränder, wo das große Aussieben und politisch verantwortete Herumwursteln stattfindet, gibt es auch heute noch genügend Potenzial für Kollektivinteressen – von den vielen anderen einmal abgesehen, genannt sei hier nur beispielhaft der NSA-Überwachungsskandal.
Wer seine Ressourcen nicht ausschöpft und sich nicht effizienter macht für das „Steigerungsspiel“, gerät beim Drehen leicht ins Trudeln – oder schlimmer, er dreht sich erst gar nicht. Wo Selbstoptimierung, Selbstmanagement und permanente Flexibilität zwingender Bestandteil eines Spiels sind, werden Freiheitsressourcen, wie Rosa das nennt, wieder eingezogen. Das Leben wird zum „Instrument im ökonomischen Existenzkampf“.
Wer daran nicht teilnimmt oder „ausgeschieden ist“ und seine Lebenszeit vermeintlich nicht opfert, um mitzuhalten, macht sich verdächtig. Dann tauchen schnell Begriffe, wie „soziale Hängematte“ oder „spätrömische Dekadenz“ auf. Zeit als den kostbarsten Rohstoff gönnt man niemand anderem gern.
Und so werden wir wohl leider lang und vergeblich darauf warten, dass ein Heer von Arbeitslosen, Aufstockern und Niedriglohnverdienern, die ihre Situation unerträglich finden und trotz mühevoller Anstrengungen auf der Stelle treten, ihre Rechte als BürgerInnen in der Öffentlichkeit einfordern. Zu groß ist die Scham und das Stigma von „Hartz IV“ und „prekärer Vollerwerbsarbeit“, wie eine Studie des Jenaer Soziologen Klaus Dörre belegt (1), der gemeinsam mit Hartmut Rosa und Stephan Lessenich das „Kolleg Postwachstumsgesellschaften“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ins Leben gerufen hat.
Und ebenso lange und vergeblich werden wir darauf warten, dass dies einmal am 1. Mai geschieht, dem „Tag der Arbeit“. Da hilft vermutlich auch kein ZEIT-Artikel von 2013, der den „Adel der Arbeitslosigkeit“ ausrufen will – so engagiert das auch sein mag.
Die Möglichkeit kollektiver Utopie-Entwürfe schwindet dort, wo Menschen auf sich selbst verwiesen sind, auf ihre Probleme und ihren „ökonomischen Existenzkampf“, der unmittelbar hier und jetzt spielt. Nicht morgen oder übermorgen. Zukunft hat im endlosen Steigerungsspiel des Kapitalismus ihre Bedeutung verloren.
Verweise:
(1) Prof. Dr. Klaus Dörre u.a.: „Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik“. Campus Verlag 2013.
Weiterführende Links:
Bei MDR-Figaro zum Nachhören: „Hat sich der Kapitalismus totgesiegt?“, Vortrag von Prof. Dr. Hartmut Rosa
Prof. Dr. Stephan Lessenich, Prof. Dr. Hartmut Rosa, Prof. Dr. Klaus Dörre u.a. „Kolleg Postwachstumsgesellschaften“ an der FSU Jena